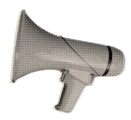Abkommen: EU - Chile
Freihandelsabkommen zwischen EU und Chile.
Von Jörg Kronauer (jw, 24.12.2022)https://www.jungewelt.de/artikel/441114.rohstoffe-neokolonialismus-in-gr%C3%BCn.htmlBrüssel feiert es, in Lateinamerika aber trifft es bei nicht wenigen auf scharfe Kritik: das erneuerte, deutlich ausgeweitete Freihandelsabkommen zwischen der EU und Chile, auf das sich beide Seiten am 9. Dezember geeinigt haben. Rein formal handelt es sich um eine Aktualisierung des bestehenden Assoziierungsabkommens aus dem Jahr 2002, das den EU-Staaten bzw. ihren Unternehmen schon heute einen privilegierten Zugang zum chilenischen Markt verschafft. Allerdings geht es über die bisherigen Regeln ein gutes Stück hinaus. So gewährt es Investoren aus der EU in Chile die gleichen Rechte wie einheimischen. Es nimmt der Regierung in Santiago außerdem Optionen, den Export chilenischer Rohstoffe zu beschränken. Das ist äußerst günstig für die deutsch-europäische Energiewende: Mehr als 60 Prozent des EU-Lithiumimports kommen aus Chile; auch sind künftige Lieferungen grünen Wasserstoffs im Gespräch. Das Freihandelsabkommen, so heißt es in Brüssel, trage dazu bei, Europa eine ökologische Zukunft zu garantieren.
Enger an China
Alles gut also? Mitnichten. Über 500 Organisationen und Einzelpersonen haben inzwischen einen Aufruf unterschrieben, der an dem neuen Abkommen kein gutes Haar lässt – aus gutem Grund. Der Aufruf, initiiert von chilenischen Kritikern, unterzeichnet zum Beispiel auch von der internationalen Kleinbauernorganisation Via Campesina oder dem französischen Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon, nimmt sich exemplarisch den grünen Wasserstoff vor, den Brüssel aus Chile zu importieren plant. Um ein Kilogramm davon herzustellen, benötige man zehn Liter Süßwasser und größere Mengen erneuerbarer Energien, die man mit Solar- und Windanlagen auf landwirtschaftlich nutzbaren Flächen gewinnen müsse, heißt es in dem Appell; anstatt Nahrung für Entwicklungs- und Schwellenländer zu produzieren, gewinne man Energieträger für Autofahrer im reichen Westen, die sich zu fein sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Das neue Freihandelsabkommen sei schlicht »ein Ausdruck des Neokolonialismus«, der in diesem Fall »der Elektromobilität der EU« diene, also »grünen« Zwecken.
Das erweiterte Freihandelsabkommen, das Brüssel mit Chile geschlossen hat – es muss nun noch von den EU-Mitgliedstaaten ratifiziert werden –, ist recht charakteristisch für das neue Verhältnis zwischen Lateinamerika und der EU. Insgesamt haben die Beziehungen, so formulierte es kürzlich die regierungsnahe Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), »vor allem im letzten Jahrzehnt an Intensität und Relevanz verloren«. Lateinamerika bindet sich immer enger an China und setzt sich dabei, zum Beispiel bei der Nutzung von Huawei-Technologie für 5G, immer öfter gegen Widerstände aus den USA durch. China ist inzwischen zweit-, in Südamerika sogar größter Handelspartner; die EU liegt nur noch auf Platz drei, und wenngleich sie beim Altbestand an Direktinvestitionen noch Nummer eins ist: Tatsächliche wirtschaftliche Dynamik entfaltet sie kaum. »Es fehlt an Projekten, die der Zusammenarbeit Sinn und Zweck verleihen«, konstatiert die SWP; kurz: Europa ist in Lateinamerika, wo es einst im Windschatten der Vereinigten Staaten prosperierte, auf einem absteigenden Ast.
Wiederbelebung schwierig
Was tun? Aktuell setzt die EU vor allem auf zweierlei. Zum einen will sie die bestehenden Freihandelsabkommen ausdehnen und neue schließen. Neben dem mit Chile soll auch das Freihandelsabkommen mit Mexiko erweitert werden; darüber hinaus ist geplant, den Machtwechsel in Brasilien von Jair Messias Bolsonaro hin zu Luiz Inácio Lula da Silva zu nutzen, um endlich das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur (Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay) zu ratifizieren. So soll den lahmenden Wirtschaftsbeziehungen wieder Schwung verpasst werden. Hinzu kommt, dass wenigstens einige Staaten Lateinamerikas Rohstoffe besitzen, die für die Energiewende wichtig sind, vor allem Lithium; Chile, Argentinien und Bolivien verfügen über riesige Mengen davon. Den eigenen Zugriff darauf zu stärken, das gilt in Berlin und Brüssel als angesagt.
Wird dieser Zweiklang – Freihandel plus »Rohstoffpartnerschaften« – genügen, um die alten Beziehungen zwischen der EU und Lateinamerika wiederzubeleben? Man darf wohl skeptisch sein: Die Freihandelsabkommen etwa mit Chile und Mexiko sind schließlich nicht neu; und »Rohstoffpartnerschaften« mit Chile und Peru hat die Bundesrepublik bereits vor fast zehn Jahren geschlossen, ohne dass es den Beziehungen wirklichen Schub verliehen hätte. »Ohne eine grundlegende Neuorientierung«, vermutet denn auch die SWP, »wird sich das deutsche und europäische Verhältnis zu Lateinamerika nicht revitalisieren lassen.« Eine Neuorientierung aber ist in der EU nicht in Sicht; selbst ihr Lithium- und Wasserstoffimport verharrt in den Strukturen des Neokolonialismus, wenn auch diesmal in grünem Gewand.
CETA beschlossen
Von Kurt Stenger (nd, 02.12.2022)
Die Rufe aus der Zivilgesellschaft blieben letztlich ungehört. Obwohl sich ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, Umwelt- und weiteren gesellschaftlichen Organisationen gegen die Ratifizierung des »Umfassenden Handels- und Investitionsschutzabkommens« (engl. Kürzel: CETA) zwischen der EU und Kanada aussprach,
stimmte der Bundestag am 01.12.2022 mehrheitlich für die CETA-Ratifizierung.
Die Bundesregierung sei gerade »im Begriff, die Weichen rückwärts zu stellen«, kritisierte Margot Rieger vom Netzwerk Gerechter Welthandel. Von einer »modernen und nachhaltigen« Handelsagenda oder gar einem »Neustart«, wie die Bundesregierung sie versprochen habe, könne keine Rede sein.
Das Abkommen war über viele Jahre heftig umstritten und zeitweilig schon tot geglaubt gewesen. Bereits 2009 hatten die Verhandlungen zwischen der EU und Kanada begonnen, nach fünf Jahren war man sich handelseinig. Aufgrund heftiger Kritik aus einzelnen EU-Staaten und von Nichtregierungsorganisationen dauerte es weitere zwei Jahre, bis der Europäische Rat nach Zustimmung aller 28 Regierungen, die EU-Kommission und die kanadische Regierung eine überarbeitete CETA-Variante unterzeichneten. Doch die Streitigkeiten gingen erst richtig los.
Der Ärger hatte schon damit begonnen, dass die Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurden. Lediglich durch einen Leak wurde zunächst ein Kapitel bekannt. Erst nach der Einigung veröffentlichte die EU einige Eckdaten aus dem über 500-seitigen Vertragstext – etwa zum Zollabbau, dem Zugang europäischer Firmen zu öffentlichen Ausschreibungen in Kanada sowie zum Schutz des geistigen Eigentums und regionaler Herkunftsbezeichnungen für Agrarprodukte. Der kritischste Punkt wurde noch später bekannt: Um Investitionen anzukurbeln, sollen weitreichende Möglichkeiten für Investoren geschaffen werden, vor internationalen Schiedsgerichten gegen alle möglichen staatlichen Maßnahmen zu klagen. Da einige EU-Staaten und insbesondere das Regionalparlament Walloniens in Belgien gegen die Ratifizierung zu stimmen drohten, wurde dieser Passus bezüglich der Klagerechte konkretisiert. Außerdem sollten nicht mehr private Schiedsgerichte zuständig sein, sondern ein erst zu schaffendes »Investitionsgerichtssystem«.
Die Kritiker überzeugte das nicht: Auch dabei handle es sich um »eine Paralleljustiz, die nur von ausländischen Investor*innen, nicht aber von einheimischen Betrieben angerufen werden kann«, wie es die Kampagnenorganisation Campact ausdrückte. Schließlich einigten sich die EU-Staaten darauf, CETA ab 2017 lediglich vorläufig anzuwenden und zwar ohne die Regeln zum Investitionsschutz.
Auch dies war umstritten. In Deutschland herrschte eine zunehmende Antifreihandels-stimmung im öffentlichen Diskurs. Die Globalisierungskritiker hatten zudem durch den Stopp der Verhandlungen über das weit bedeutendere TTIP-Abkommen mit den USA starken Rückenwind bekommen. Während nur CDU und FDP uneingeschränkt für CETA und die Grünen, Die Linke sowie die AfD dagegen waren, wurde die uneinige SPD zum Zünglein an der Waage. Erst der massive Einsatz von Parteichef und Vizekanzler Sigmar Gabriel sorgte für knappe Zustimmung auf einem Parteikonvent.
Die Frage der Ratifizierung, womit das Abkommen erst völkerrechtlich wirksam wird, wurde indes verschoben mit Verweis auf beim Bundesverfassungsgericht anhängige Klagen. Die letzte wies Karlsruhe im März dieses Jahres ab – hier ging es um die Frage, ob die EU beim Abschluss des Vertrages jenseits ihrer Kompetenzen agiert hatte. Somit landete das Thema wieder auf der politischen Agenda.
Doch die Ampel war längst in den Startlöchern.
Die FDP hatte dafür gesorgt, dass die CETA-Ratifizierung samt kleineren Nachbesserungen in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Und sie hofft auf mehr: »einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA«, wie es der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, ausdrückte.
Tatsächlich ist es wohl vor allem die veränderte Weltlage, welche die aus der Mode gekommenen bilateralen Freihandelsabkommen wieder relevanter machen könnte. Vertiefte Beziehungen zu befreundeten Ländern rücken in den Vordergrund. Zum Ärger von NGOs, denen besonders das Umfallen der Grünen in dieser Frage sauer aufstößt: »CETA ist ein völlig veraltetes Abkommen«, kritisiert Uwe Hiksch, Vorstand des Umweltverbands Naturfreunde Deutschlands, und reibt den Grünen unter die Nase: »Während es den Handel mit fossilen Energien schützt, sind für die Pariser Klimaziele oder die ILO-Kernarbeitsnormen keine sanktionsbewehrten Durchsetzungsmechanismen vorhanden.«
EU-Mercosur-Abkommen
Quelle: https://www.dw.com/de/r%C3%BCckenwind-f%C3%BCr-eu-mercosur-abkommen/a-53979587
29.06.2020
Deutschland will das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay vorantreiben. Das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mehrfach öffentlich erklärt. Auch im Auswärtigen Amt in Berlin hofft man, dass das Abkommen weiterkommen könnte im Ratifizierungsprozess. Die Mercosur-Staaten seien wirtschaftlich und geopolitisch ein wichtiger Partner der EU, heißt es im Auswärtigen Amt. Den wolle man auf jeden Fall stärken.
Das Abkommen müssen alle 27 Mitgliedsstaaten sowie das EU-Parlament verabschieden. Doch die Chancen dafür stehen im Moment schlecht. Denn bereits drei europäische Parlamente haben angekündigt, dass sie dem Abkommen nicht zustimmen werden: die Volksvertretungen von Österreich, den Niederlanden und Wallonien in Belgien. Ihre Argumente sind die gleichen wie die der Nichtregierungsorganisationen.
Bauern fürchten Einbußen und fehlenden Umweltschutz
Vor allem Brasilien unter Präsident Jair Bolsonaro steht im Zentrum der Kritik. Einerseits werde der Umwelt- und Amazonasschutz in den Verträgen nicht genügend berücksichtigt. Es fehlten Sanktionsmechanismen, wenn etwa Brasilien nichts gegen die zunehmenden Amazonasbrände unternehme oder Bergbaukonzernen erlaube, in Indigenen-Reservaten zu schürfen. Die Gegner des Abkommens führen auch die Attacken der amtierenden Regierung gegen den Rechtsstaat, Menschenrechte und die Demokratie an.
Andererseits stören sich europäische Landwirte und Verbraucher an den höheren Quoten für Agrarimporte aus Südamerika, die das Abkommen vorsieht. Sie monieren auch geringere Standards für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie die Zerstörung von Naturräumen durch Großfarmer. Die Agrarlobbys ziehen am gleichen Strang. Frankreich, Irland und Wallonien befürchten, dass die eigenen Landwirte Einbußen erleiden, wenn südamerikanische Farmer ohne Zölle nach Europa exportieren können. Vor allem Rinderzüchter üben massiven Druck aus, um das Abkommen zu stoppen.
Industrievertreter in Europa befürchten, dass die Verhandlungen niemals abgeschlossen werden, wie einst für TTIP, das umstrittene Transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA.
Profitversprechen für Europas Industrie
Das EU-Mercosur-Abkommen würde mit 780 Millionen Konsumenten den größten Markt der Welt schaffen, mit rund einem Viertel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Der Deal wäre der wirtschaftlich bedeutendste, den die EU bislang abgeschlossen hat. Für europäische Unternehmen öffnete sich in Südamerika ein Markt mit 260 Millionen Konsumenten. Gerade die deutsche Industrie würde stark profitieren, wenn Exporte in die Mercosur-Staaten erleichtert wären. Die bislang hohen Einfuhrzölle etwa auf Autos, Maschinen oder Chemieprodukte sollen schrittweise abgeschafft werden. Die Unternehmen würden allein dadurch rund vier Milliarden Euro pro Jahr sparen.
Auf die Widerstände in den EU-Staaten könnte die EU mit Zusatzvereinbarungen außerhalb des eigentlichen Vertrages reagieren. Beim CETA-Abkommen mit Kanada wurden 2016 wichtige Auslegungsfragen in einer separaten politischen Erklärung festgehalten. Dies könnte zum Muster für das Mercosur-Abkommen werden.
Doch die Zeit wird knapp: Der umfangreiche Handelsvertrag wird derzeit rechtlich feingeschliffen und in sämtliche EU-Amtssprachen übersetzt. Frühestens Ende des Jahres, vermutlich eher Mitte 2021, könnte der Vertrag zur Abstimmung vorgelegt werden. Doch ob die EU neben den Verhandlungen zum Brexit dafür noch Kapazitäten freihalten kann, ist zweifelhaft.
Argentinien bremst Euphorie
Auch in Südamerika ist die anfängliche Euphorie einer neuen Nüchternheit gewichen: Argentinien führt unter der Mitte-Links-Regierung von Alberto Fernández gerade Preis-, Devisen-, Handels- und Kapitalkontrollen ein, welche dem Freihandel diametral entgegenstehen. Brasilien hat verkündet, dass man sich nicht am langsamsten Partner orientieren solle, sondern notfalls auch ein flexibles Ratifizierungsmodell anwenden könnte. Danach könnten die vier Mercosur-Staaten das Abkommen unterschiedlich schnell umsetzen.
Der brasilianische Wirtschaftsminister Paulo Guedes sieht das Abkommen als Katalysator für Reformen in Brasiliens Volkswirtschaft. Brasilien hofft, seine Ausfuhren nach Europa bis 2035 auf 100 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln zu können. Ohne Freihandel kann das nicht gelingen.
JEFTA in Kraft getreten
Handelsabkommen JEFTA in Kraft getreten
Von Andreas Fisahn
Es wirkt schon beinahe trotzig, dass das Handelsabkommen JEFTA zwischen der EU und Japan am 01.02.2018 in Kraft getreten ist. Die Zeichen der Zeit deuten eher auf ein Ende des "Freihandels" hin. Nicht, weil es ökonomische Verlierer gibt, sondern weil diese die militärisch und politisch starken USA sind.
US-Präsident Donald Trump pfeift auf bilaterale Abkommen genauso wie auf die Welthandelsorganisation (WTO), weil die Leistungsbilanz für die USA negativ ist. Die "Exportnation" Deutschland hat dagegen auf den ersten Blick ein Interesse, dass in der Welt weiter offene Grenzen für Waren, Kapital und Dienstleistungen existieren.
Was wurde mit JEFTA vereinbart? Nicht, dass die Zölle sinken - dazu braucht es kein besonderes Abkommen, dafür reichen die bestehenden Institutionen WTO und das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT). Vielmehr soll der Kapital- und Dienstleistungsverkehr "erleichtert" werden. Dazu braucht es Marktöffnungen, insbesondere für Finanzdienstleistungen. Oder anders gesagt: Unter Druck geraten bei den "modernen" Handelsabkommen die öffentlichen Dienstleistungen, die nun als Konkurrenzgeschäft betrieben werden müssen.
Außerdem sollen die "nichttarifären Handelshemmnisse" beseitigt werden, und das sind in der Regel die Schutzvorschriften für Verbraucher, Beschäftigte oder die Umwelt. Beim Handelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) gab es Streit, ob Brüssel allein entscheiden kann, oder ob alle 28 nationalen Parlamente (GB zählte noch dazu) zustimmen müssen. Der Europäische Gerichtshof meinte, die Schiedsgerichtsverfahren für Unternehmen seien Angelegenheit der Mitgiledsstaaten. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sah sogar noch weitere Bereiche in deren Kompetenz: "Der Europäischen Union dürfte es unter anderem an einer Vertragsschlusskompetenz für Portfolioinvestitionen, den Investitionsschutz, den internationalen Seeverkehr, die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen und den Arbeitsschutz fehlen"
Bekannt ist, dass der Investitionsschutz bei JEFTA ausgenommen ist. Ansonsten hat die EU-Kommission die Wörtchen "unter anderem" geflissentlich übersehenund die Lsite des BVerG so eng wie möglich geschnitten, von der Dienstleistungsfreiheit abgesehen.
Auch wenn die deutsche Industrie auf Export angewiesen ist, die Hymne vom "freien" Wettbewerb ist ein Oldie. Längst geht es darum, Industriepolitik zu betreiben, neue Technologien mit staatlichen Investitionen zu entwickeln, Synergien zwischen den Großen zu produzieren und die "eigene" Wirtschaft vor chinesischen Übernahmen zu schützen.