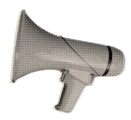Dr. Werner Rügemer liest aus seinem Buch "Der Bankier".
Am 13. November 2007 las der Kölner Korruptionsexperte Dr. Werner Rügemeraus seinem Buch "Der Bankier - Ungebtener Nachruf auf Alfred Freiherr von Oppenheim". Rügemer war einer Einladung der Attac-Gruppe Fulda gefolgt. Die Lesung fand im Cafe Ideal vor ca. 70 Besuchern statt. "
Dr. Rügemer "schildert die in seinem "ungebetenen Nachruf" die in der Öffentlichkeit unbekannten Praktiken der Privatbank Europas, die zur Bereicherung ihrer 6.000 vermögenden Kunden sowie zur Verschuldung von Staat und Kommunen führen." (Zitat aus dem Klappentext des Buches)
Die Publikation des "Nachrufs" löste eine Prozesslawine gegen Dr. Rügemer aus. Die Klagen gegen Rügemer richten sich nicht gegen die Kernaussagen des Buches, sondern gegen Bagatellfehler. Die Kernaussage des Buches kann jedenfalls als gesichert gelten: Mit Public-Private-Partnership- Projekten, die in Köln durch die Oppenheimbank eingefädelt worden waren, wurde die Kölner Kommune stark belastet, während die Klientel des Baron Oppenheim eine zweistellige Rendite einstreichen konnte. Mit Hilfe von Politikern und unter der Ägide des Baron Oppenheim gelang es so einer kleinen Clique, Staatsgelder in Privatgewinne zu "transformieren". Dieser Transformationsmechanismus ist kennzeichnend für PPP-Projekte.

Die Veranstaltung wurde vom Offenen Kanal Fulda aufgezeichnet. Mehrere Mitglieder der Attac Gruppe machten sich dabei als Kameraleute nützlich.

Der Film kann auf unserer Download-Seite gratis heruntergeladen werden.
Dr. Rügemer zu Privatisierungen in Deutschland
Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Rügemer über Privatisierungen in Deutschland
Am 22. Mai 2007 hielt der Kölner Korruptions- und Privatisierungsexperte Dr. Rügemer im Felsenkeller in Fulda einen Vortrag zum Thema Privatisierung in Deutschland. Organisiert wurde die Veranstaltung von Verdi, Bezirk Osthessen, und der Ortsgruppe Attac. Dem Veranstaltungshinweis waren knapp 70 Zuhörer und Zuhörerinnen gefolgt. Rolf Müller, hauptamtlicher Betriebsrat des Fuldaer Klinikums, moderierte die Veranstaltung.

Dr. Werner Rügemer beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Privatisierung. Dass Privatisierungen ein interessanter wenngleich auch beunruhigender Untersuchungsgegenstand sind, musste Dr. Rügemer Anfang der 90er Jahre in seiner Heimatstadt erleben, als die Stadt zusammen mit RWE eine Müllverbrennungsanlage baute und betrieb. Bei Projekten dieser Art handelt es sich um sogenannte funktionale Privatisierungen. Zu den funktionalen Privatisierungen werden die Public Private Partnerships (kurz PPP) gerechnet, die auch öffentlich-private Partnerschaften genannt werden. Gemäß der offiziellen Definition, vereinigen Public Private Partnerships die Kompetenzen von öffentlicher Hand und Privatinvestoren. Das Ziel ist mehr „ökonomische Effizienz“ für die Bürger. Ein PPP-Projekt kann etwa darin bestehen, dass ein Privatinvestor für die öffentliche Hand Gebäude errichtet und dann an sie vermietet oder eine gewisse Aufgabe, z.B.die Müllbeseitigung, erfüllt. In Köln geriet die Public Private Partnerschaft zu einer Farce aus Korruption und Staatsknetenabzocke. Insgesamt flossen Schmiergelder in Höhe von über 20 Millionen DM, damit die Verantwortlichen das Projekt politisch durchwinken konnten. Das Resultat war eine überdimensionierte Müllverbrennungsanlage, die offiziell für 420.000 Tonnen Müll pro Jahr geplant worden war, die aber, wie sich während des Skandals ergab, Kapazitäten von 650.000 Tonnen aufwies. Neben der Schmierenkomödie ihrer Stadtgranden mussten die Kölner Gebührensteigerungen über sich ergehen lassen, die Folge der Überdimensionierung waren. Der Kölner Müllskandal offenbart, so Dr. Rügemer, die Grundproblematik von Privatisierungen und PPP-Projekten: die vollkommene Intransparenz der ihnen zugrunde liegenden Verträge und die daraus resultierenden negativen Folgen für die Bürger.
Intransparenz und Ausschaltung der parlamentarischen Kontrollgremien
Das nächste Beispiel, das Rügemer gab, führte auf die Bundesebene: Toll Collect. Das Toll-Collect-Projekt liefert ein Paradebeispiel dafür, wie sich politische Entscheidungsträger der höchsten Ebene von ausgefuchsten Wirtschaftsanwälten internationaler Großkanzleien sowie Großinvestoren manipulieren lassen und politische Kontrollgremien zugunsten der Investoren und zuungunsten des Steuerzahlers systematisch ausgeschaltet werden.
Zur Erinnerung: Das Toll-Collect-Projekt startete 2002 und hatte die Aufgabe ein satellitengestütztes Mauterfassungssystem für LKW zu installieren. Das Toll-Collect-Konsortium setzte sich aus Daimler-Chrysler, Telekom und dem französischen Konzern Coufiroute zusammen. Die Betreiber sollten das Mautsystem errichten, für 12 Jahre betreiben und die eingenommenen Gebühren abzüglich einer Provision an die Regierung abführen. Ursprünglich sollte das Mautsystem zum 31. August 2003 in Betrieb gehen. Doch die Betreiber konnten den Termin nicht halten, wodurch dem Staat mit jedem Monat Verzögerung milliardenhohe Einbußen entstanden. Als im Bundestag Stimmen laut wurden, das Verkehrsministerium müsse auf Schadenersatz klagen, stellte sich heraus, dass niemand, inklusive der Mitarbeiter des Verkehrsministeriums, den Toll-Collect-Vertrag gelesen hatte. Das war nicht verwunderlich, denn die Wirtschaftskanzlei Freshfields, die für die Ausarbeitung des Vertrages verantwortlich zeichnete, hatte ganze Arbeit geleistet: Zum einen war der Vertrag zu einem Konvolut von über 17.000 Seiten geraten und daher auch für eine größere ministeriale Arbeitsgruppe innerhalb kurzer Zeit nicht lesbar, zum anderen enthielt das Vertragswerk eine Klausel, die es dem Unterzeichner unter Strafandrohung untersagte, den Vertrag der Öffentlichkeit vorzulegen. Zu ihrem Erstaunen erfuhren die besorgten Bundestagsabgeordneten von den Freshfields-Anwälten, dass der Deutsche Bundestag im Sinne des Toll-Collect-Vertrages zur Öffentlichkeit zu rechnen sei. Der Deutsche Bundestag war also nicht berechtigt, das Vertragswerk einzusehen. Als einige Abgeordnete auf Einsicht beharrten, schrieb die Kanzlei Freshfields eine ca. 200 Seiten dünne Fassung zusammen, die aber nicht dem Bundestag, sondern lediglich zwei Dutzend Abgeordneten des Haushaltsausschusses, vorgelegt werden durfte. Diese Kurzfassung durfte allerdings nur im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung eingesehen werden; die Mandatsträger hatten mithin nicht genügend Zeit, das Vertrags-Fragment eingehend zu studieren.
Als 2006 Mitglieder des Bundestages den Vertrag unter Bezugnahme auf das kurz zuvor in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz, das es der Öffentlichkeit erlaubt, in die Unterlagen von Bundesbehörden einzusehen, lesen wollten, wurde ihnen dies von Freshfields verwehrt. Denn das Informationsfreiheitsgesetz, so die Begründung der Anwälte, erstrecke sich nicht auf Dokumente, die Militär- oder Betriebsgeheimnisse betreffen. Bis heute hat kein Abgeordneter des Bundestags den vollständigen Toll-Collect-Vertrag einsehen dürfen.
Die Ministerialriege des Verkehrsministeriums, die den Vertrag einsehen durfte, war jedoch nicht in der Lage, das Gesetzeswerk, das übrigens gar nicht erst ins Deutsche übersetzt worden war, zwecks Schadenersatzklage zu interpretieren. Daher musste eine weitere Wirtschaftskanzlei beauftragt werden, den Text für das Verkehrsministerium zu interpretieren. Die „Interpretation“ des Vertragswerkes bescherte den Mandatsträgern eine weitere unangenehme Überraschung: Die Schadenersatzklage durfte nicht vor einem ordentlichen Gericht eingebracht werden. Der Vertrag sah für den Streitfall die Einberufung eines Schiedsgerichtes vor. Laut Vertrag muss sich das Schiedsgericht aus einem Vertreter des Konsortiums, einem Vertreter der öffentlichen Seite und einem Neutralen zusammensetzen. Bis heute ist nicht bekannt, ob dieses Schiedsgericht jemals zusammengetreten ist.
Der Fall Toll-Collect spielte sich auf höchster politischer Ebene ab. Viele Bundestagsabgeordnete sind Juristen, dennoch gelang es der Investorenseite mit Hilfe von Freshfields einen Vertrag durchzusetzen, der dem Staat von vorneherein eine unzumutbare juristische Position zuwies. Erstaunlich ist das Toll-Collect-Debakel auch deswegen, weil der Bundestag über optimale Kapazitäten zur Prüfung von Verträgen verfügt. Dem Bundestag steht ein wissenschaftlicher Dienst zur Seite, jede Fraktion hat Referenten und es existieren Budgets zur Berufung von Experten.
Man kann sich leicht vorstellen, um wieviel leichteres Spiel renditeorientierte Investoren mit Kommunalpolitikern haben, die ihre Ämter zum Teil in der Freizeit ausüben, und weder die Zeit noch die juristische Ausbildung haben, sich mit Verträgen eingehend auseinander zu setzen, die einen Umfang von mehreren Tausend Seiten haben.
Geheime Gewinngarantien zu Lasten der Bürger
Dr. Rügemer führte die Zuhörer anschließend auf die kommunale Ebene, wo seit einigen Jahren bundesweit Public Private Partnerships (PPP) von Politikern aller Farben propagiert und durchgeführt werden. Die PPP-Verträge weisen in der Regel den gleichen Webfehler auf wie der Toll-Collect-Vertrag: Die Verträge werden vor der Öffentlichkeit, selbst vor den Entscheidungsträgern der politischen Gremien, geheimgehalten und entziehen sich somit der demokratischen Kontrolle. Da die Verträge den Abgeordneten nicht bekannt sind, wird ihnen zudem eine effektive Kontrolle der Vertragsumsetzung unmöglich gemacht. Die demokratische Kontrolle der Vertragsumsetzung wäre aber gerade bei PPP-Projekten notwendig, erstens, weil es um sehr viel Geld geht und zweitens, weil die Projekte in der Regel Laufzeiten von 20-30 Jahren haben. Die Begründung für diese Geheimhaltung ist immer die gleiche, nämlich der Verweis auf das zu schützende Betriebsgeheimnis des Investors. Hinzu kommt, dass der Auftragsvergabe oft keine ordnungsgemäßen Ausschreibungen vorausgehen, weswegen PPP-Verträge häufig in der Schweiz unterzeichnet werden. Denn in der Schweiz müssen Verträge nicht auf Übereinstimmung mit den geltenden EU-Ausschreibungsvorschriften geprüft werden.
Ein weiteres Merkmal vieler PPP-Projekte ist die Gewinngarantie, die die öffentliche Hand den Investoren vertraglich zusichert. Die Brisanz dieser Garantien wird deutlich, wenn man den §3 Absatz 4 des 1994 verabschiedeten Fernstraßenprivatisierungsgesetzes liest. Dieser Passus ist für die Renditenfestschreibung in PPP-Projekten die allgemein gültige Bezugsgröße:
Als angemessene kalkulatorische Verzinsung des von dem Privaten eingesetzten Eigenkapitals gilt die durchschnittliche Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen in einem Zeitraum von 20 Jahren, die der jeweiligen Kalkulationsperiode vorausgehen, zuzüglich eines unternehmerisch angemessenen Risikozuschlags.
Für jedes Jahr der Vertragslaufzeit muss der „unternehmerisch angemessene“ Risikozuschlag neu berechnet werden. Die Bezugsgrößen sind die auf den Finanzmärkten jeweils erzielbaren Renditen. So überrascht es nicht, dass der „angemessene“ unternehmerische Risikozuschlag plus der Sockelverzinsung der durchschnittlichen Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, dem Investor oft eine zweistellige Rendite garantiert. Als Beispiel für eine geheim abgeschlossene Gewinngarantie auf Kommunalebene nannte Dr. Rügemer die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe. Im Jahr 2000 hatte die Stadt Berlin 49% der Berliner Wasserwerke an RWE und den französischen Konzern Viola verkauft. In den sechs Jahren seit der Teilprivatisierung haben die Wasserbetriebe 800 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Das klingt zunächst gut. Man könnte annehmen, dass die Stadt Berlin 51% der Gewinne für sich hätte verbuchen können, da sie ja 51% der Anteile an den Wasserbetrieben besitzt. Wäre da nicht die im Vertrag vereinbarte Gewinngarantie, die der privaten Seite einen höheren Gewinn zusichert. Ingesamt strichen RWE und Viola 650 Millionen Euro der Gewinne ein. Damit erschöpft sich die Problematik der Teilprivatisierung der Berliner Wasserwerke aber nicht. Wichtig ist auch ein Blick auf die Art, wie diese Gewinne zustande kamen. Die Wasserpreise sind in Berlin in den Jahren seit der Teilprivatisierung um über 40% gestiegen. Damit liegt Berlin europaweit an der Spitze. Nicht unerwähnt bleiben sollte der Abbau von über 1700 Arbeitsplätzen in den Berliner Wasserwerken. (Das entspricht über einem Viertel der ursprünglichen Belegschaft.) Durch die Entlassungen wälzen die Wasserbetriebe ihre Kosten auf die Sozialkassen des Staates ab.
Wenn Staat und Private gemeinsam ein Unternehmen führen, folgen daraus weitere Konsequenzen. Damit Privatinvestoren Anteile an einem staatlichen Betrieb kaufen können, muss zunächst dessen Rechtsstruktur geändert werden. Dadurch unterliegt der Betrieb fortan dem Privatrecht und nicht mehr dem öffentlichen Recht. Wird ein öffentlicher Betrieb teilprivatisiert und bspw. in eine GmbH umgewandelt, erwerben die Stadtspitzen automatisch Aufsichtratsposten in dem Kooperationsunternehmen. Die Amtsträger unterliegen dann innerhalb ihrer Aufsichtsratstätigkeiten dem Privatrecht. Daraus folgt juristisch, dass sie als Aufsichtsräte ausschließlich der Gewinnorientierung des Unternehmens verpflichtet sind und nicht mehr dem Interesse der Bürger. Das kann bedeuten, dass städtische Vertreter die Bürger auch dann nicht informieren dürfen, wenn deren Interesse durch unrechtmäßige Preissteigerungen bedroht ist.
Aufgabe der vertraglichen Rechte seitens der Kommune bei Public Private Partnerships (Forfaitierung mit Einredeverzicht)
Ein bei PPP-Projekten übliches Element der vertraglichen Kaufvertragsgestaltung ist die Forfaitierung mit Einredeverzicht. Was verbirgt sich hinter diesem juristischen Begriff? Dr. Rügemer erklärte den Begriff anhand eines Beispiels. Die Stadt Offenbach hat mit Hochtief einen Vertrag über die Sanierung der 49 städtischen Schulen mit einem Gesamtvolumen von 410 Millionen Euro über eine Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen. Hochtief wird nach dem Vertragsschluss bei einer Bank vorstellig, um ihr die Forderungen gegen die Stadt – 410 Millionen Euro - zu verkaufen. Diesen Teil des Forderungverkaufs nennt man Forfaitierung (Pauschalierung). Damit dieser Forderungsverkauf rechtlich gültig werden kann, muss die Stadt Offenbach allerdings einen Einredeverzicht üben, d.h. sie sichert der Bank vertraglich zu, die monatlichen Mietüberweisungen auch dann zu leisten, wenn Hochtief seinen Vertragspflichten schlecht oder gar nicht nachkommt. Die Stadt Offenbach gibt damit ihre vertraglichen Rechte zugunsten Hochtiefs auf. Für Investoren lohnt sich die Forfaitierung mit Einredeverzicht, da sie die Vertragssumme abgezinst und abzüglich der Inflationsrate am ersten Tag ausgezahlt bekommen. Auch die Banken mögen solche Verträge, ist die öffentliche Hand doch der zuverlässigste Schuldner. Die einzige Seite, die bei diesem Spiel verliert, ist die Kommune. Sie liefert sich dem Investor durch den Einredeverzicht und die daraus resultierende Aufgabe der Mieterrechte bedingungslos aus.
Fragwürdige positive Haushaltseffekte, Verschleuderung öffentlichen Vermögens und Steuerausfälle
Eine weitere Privatisierungsvariante, die sich bundesweit bei Bürgermeistern und Stadtkämmerern zunehmender Beliebtheit erfreut, ist der Verkauf von städtischen Wohnungsbaugesellschaften. In die Schlagzeilen geriet diese Privatisierungsform, als die Stadt Dresden Anfang des letzten Jahres die Wohungungsbaugesellschaft WOBA und damit 48.000 Wohnungen an den amerikanischen Investor Fortress für 1,75 Mrd. Euro verkaufte. Fortress hatte bereits vier Jahre zuvor 81.000 Wohnungen von der Gagfah, der Immobiliengesellschaft der Bundesanstalt für Angestellte, für 3,5 Milliarden Euro gekauft. Die Wohnungen befanden sich teilweise in bester Lage in Frankfurt und Berlin (allein in Berlin wurden über 20.000 Wohnungen verkauft).
Eine nähere Betrachtung zeigt aber, dass Tafelsilberverkäufe dieser Art schwerwiegende gesamt-wirtschaftliche Konsequenzen zeitigen. Zunächst einmal handelt es sich um eine geradezu skandalöse Verschleuderung von Staatsvermögen. Offensichtlich haben die Stadtspitzen sich nicht die Mühe gemacht, den Preis pro Wohnungseinheit auszurechnen. In Dresden bezahlte Fortress pro Wohnung (im Schnitt 65 qm groß) ca. 36.000 Euro. Die Argumentation, dass über 15% der Dresdner Wohnungen zum Zeitpunkt des Kaufes leer standen, greift nicht, wenn man bedenkt, das die Investoren mit den Wohnungen natürlich auch die Grundstücke erworben haben. Auch bei dem Kauf der Gagfah-Immobilien hatte Fortress bereits ein ordentliches Schnäppchen geschlagen. Die Wohnungen der Gagfah befanden sich teilweise in bester Lage in Frankfurt und Berlin (allein in Berlin wurden über 20.000 Wohnungen verkauft). Pro Wohnung zahlte Fortress lediglich etwas über 43.000 Euro und das für Wohnungen in bester Lage in Städten wie Berlin und Frankfurt. Die Gagfah hatte den Verkauf damals damit begründet, die Rentenzahlungen stabil halten zu wollen. Die 3,5 Milliarden reichten aber gerade aus, um die Renten für vier Tage auszuzahlen.
Bedenklich hätte den Stadtspitzen auch die in Private-Equity-Kreisen übliche Abwälzungs-Finanzierung der Investition erscheinen müssen. In angelsächsischen Investorenkreisen ist es üblich, nur einen Bruchteil der Kaufsumme aufzubringen, in der Regel 10-20%. Der Rest des notwendigen Kapitals wird über Kredite aufgenommen. Im Falle Dresdens finanzierte der Investor Fortress 35% der Kapitalkosten aus eigenen Mitteln, der Rest wurde kreditfinanziert. (Wenn man in Rechnung stellt, dass die meisten Geldgeber von Fortress den Großteil ihrer Einlagen ebenfalls über Kredite finanzierten, ergibt sich, dass insgesamt 90% der Kaufsumme kreditfinanziert wurden). Vor dem Kauf der WOBA gründete Fortress in Luxemburg eine Briefkastenfirma. Diese Briefkastenfirma überwies dann die Kaufsumme an den Stadtkämmerer von Dresden. Damit erwarb Fortress die WOBA mit den dazugehörigen Wohnungen. Kurze Zeit nach dem Kauf fusionierte der „Briefkasten“ mit der WOBA. Dadurch „erwarb“ die WOBA, die ja vor kurzem erst entschuldet worden war, mit einem Schlag 1,75 Mrd. Euro Schulden. Durch diese einfache und legale Rechtskonstruktion wurde ein ökonomischer Domino-Effekt ausgelöst, der von den Stadtspitzen vor dem Verkauf nicht bedacht worden war.
Zunächst verlor Dresden durch die Überschuldung der WOBA den größten Gewerbesteuerzahler der Stadt auf Jahre. Da die WOBA nunmehr überschuldet ist, muss sie zu drastischen Mitteln greifen, um sich zu sanieren. Dazu hat sie drei Möglichkeiten: Mieterhöhungen, Mitarbeiterentlassungen und Wohnungsverkauf.
So wurden knapp ein Jahr nach dem Verkauf die Mieten bei 3000 WOBA-Wohnungen um 15% erhöht. Empörte Mieter, die auf die Sozialcharta verwiesen, die zwischen der Stadt und Fortress vereinbart worden war, und die Mietsteigerung auf höchstens 2% pro Jahr vorschrieb, mussten sich belehren lassen, dass die Mieten insgesamt nicht über 2% steigen dürfen. Die Mietsteigerung um 15% bei 3.000 Wohnungen blieb auf den Gesamtbestand gerechnet unter 2% und war damit legal. Die Mieterhöhungen wirken sich für die Stadtkasse ebenfalls negativ aus, denn der steigende Mietspiegel führte zu höheren Aufwendungen für die Bezieher des Arbeitslosengeldes II (von denen es in Dresden besonders viele gibt).
Die WOBA hat außerdem angefangen, Wohnungen weiterzuverkaufen. Die Sozialcharta gilt nach dem Weiterverkauf übrigens nicht mehr, genauso wenig wie bei Neuvermietungen.
Da Fortress bereits 100.000 Wohnungen in über 140 Städten in Deutschland besaß, bevor sie die WOBA kaufte, rechnete es sich für den Investor Mitarbeiter vor Ort zu entlassen und überregionale Callcenter einzurichten. Dadurch stieg die Arbeitslosenzahl in Dresden weiter ebenso wie die Belastungen für den Haushalt. Insgesamt sind die Schulden Dresdens in der Stadt geblieben, sie haben sich lediglich juristisch verlagert. Der Großteil der Belastungen ist von den öffentlichen Kassen hin zu den Vermietern verschoben worden. Verlierer sind die 100.000 Bewohner der WOBA-Wohnungen und letzten Endes die Stadt Dresden.
Resumee
Die Privatisierungs-Revue, die Dr. Rügemer vor den Zuhörern passieren lies, dürfte bei der überwiegenden Mehrheit der Zuhörer wohl zu einer klaren Schlussfolgerung geführt haben: Privatisierung lohnt sich für Großinvestoren, Banken, Berater, internationale Wirtschaftskanzleien und sicherlich auch für Spitzenpolitiker, da die Kolateralschäden gerade bei PPP-Projekten mitunter erst Jahre nach der Vertragsschließung sichtbar werden. Für die Bevölkerung, für den Staat in seiner Gesamtheit, sind Privatisierungen schädlich. Die Schuldenkrise wird durch Privatisierungen nicht überwunden, wie gebetsmühlenartig immer wieder behauptet wird, sondern empfindlich verschärft. Die Tatsache, dass Privatisierungs-Verträge vor und nach der Unterzeichnung in einer Black Box verschwinden, schürt bei den Bürgern berechtigtes Misstrauen. Angesichts der Beispiele, die Rügemer nannte, fragt man sich als Zuhörer, was Politiker dazu treibt, für Verträge zu stimmen, die sie nicht einsehen durften.
Das in Deutschland dichtgeknüpfte Netz aus Kontrollinstanzen, das dazu dient, die Verwendung von Steuergeldern zu überprüfen, die Rechnungs- und Prüfungshöfe auf Bundesebene, die städtischen Revisions- und Prüfungsämter, dieses Kontrollnetz kann nicht wirksam werden, wenn den Beamten in den Kontrollorganen Verträge, die Steuergelder in mehrstelliger Millionen- oder Milliardenhöhe betreffen, vorenthalten werden.
Wirklich bitter ist die Erkenntnis, dass die Privatisierungseuphorie nicht nur alle Parteien ergriffen hat, sondern trotz der erbärmlichen Bilanzen ungebrochen anhält. Dr. Rügemer gab den Zuhörern am Ende der Veranstaltung den Rat, bei anstehenden Privatisierungen gar nicht erst zu versuchen, Politiker qua Diskussion und Aufklärung von diesem Ziel abzubringen, sondern statt dessen gleich ein Bürgerbegehren zu initiieren.
In der auf den Vortrag folgenden anschließenden Frage- und Diskussionsrunde wurde noch auf die Gefahren der „schleichenden“ Privatisierung hingewiesen. Solche Tendenzen machen sich in der Region bspw. bei den Abwasserverbänden bemerkbar. Auch auf die Privatisierungstendenzen im Bereich der Daseinsfürsorge wurde hingewiesen.
Im Folgenden sind die wichtigsten Kritikpunkte Dr. Rügemers noch einmal in Kurzfassung aufgeliste
- Überdimensionierung der Projekte (bei PPP-Projekten) und damit steigende Kosten
- Intransparenz durch Geheimhaltung der Verträge
- geheime Gewinngarantien des Staates an den Privatinvestor
- Steuerverluste für den Staat
- negative gesamtwirtschaftliche Effekte (Arbeitslosigkeit durch Entlassungen von Mitarbeitern im Zuge von Teilprivatisierungen)
- Aufgabe von Handlungsspielräumen seitens des Staates
- Aufgabe von Mietrechten innerhalb der Vertragsgestaltung (Fortfaitierung mit Einredeverzicht)
- Aushöhlung der Demokratie
- Korruption.